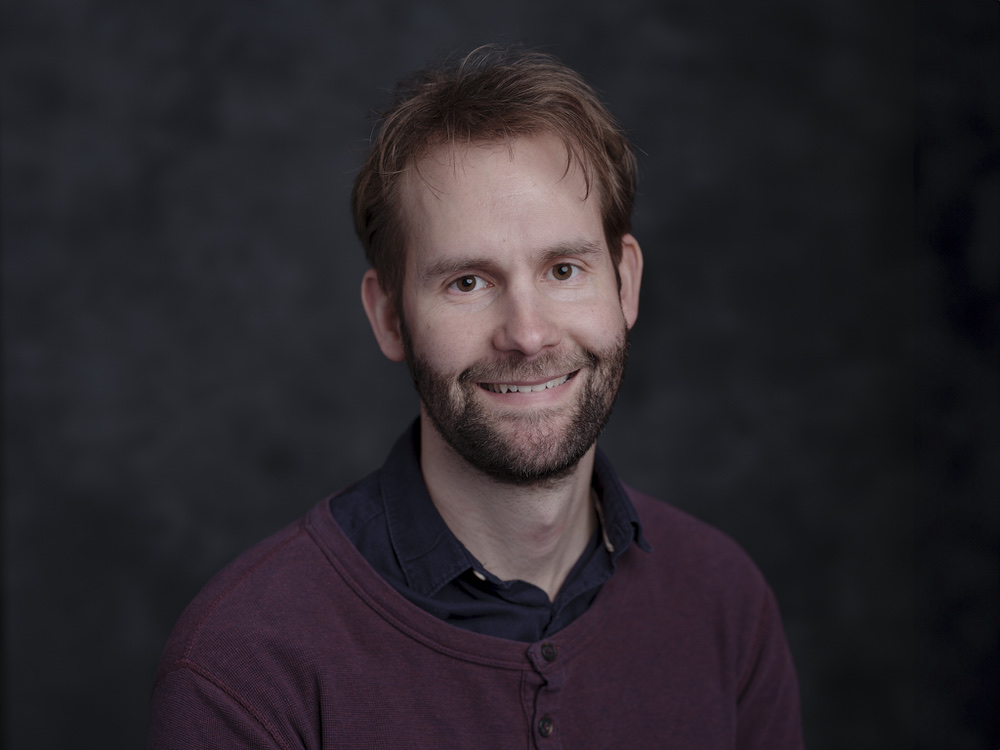Willkommen beim
Pastoralraum
Region Mellingen
Der Pastoralraum Region Mellingen ist eine Seelsorgeeinheit im Bistums Basel. Er liegt im Kanton Aargau und vereint die katholischen Pfarreien Fislisbach (seit 2023), Mellingen, Wohlenschwil-Mägenwil und Tägerig. Eingerichtet wurde er 2019. Rund 6300 Katholikinnen gehören ihm an.
Aktuelles: Neuigkeiten und Gottesdienste
Was gibt es Neues im Pastoralraum? Wann finden im Pastoralraum Gottesdienste und Anlässe statt? Wo finde ich das Pfarrblatt «Horizonte»? Hier finden Sie Informationen, die den ganzen Pastoralraum betreffen. Für weitere Informationen, schauen Sie in den einzelnen Pfarreien.
Was gibt es Neues im Pastoralraum?
Gottesdienste und Anlässe im Pastoralraum
Pfarrblatt «Lichtblick»
Seit Ende August 2024 erscheint das Pfarrblatt unter dem Namen «Lichtblick». Es vereint als «Römisch-katholisches Pfarrblatt Nordwestschweiz» das ehemalige Aargauer Pfarrblatt «Horizonte» und das Basler Pfarrblatt «Kirche heute». In der Regel erscheint es zweiwöchentlich, jeweils am Donnerstag. Die aktuelle Nummer und ältere Ausgaben lassen sich hier als pdf abrufen.
Ansprechpersonen und Kontaktadressen
Hier finden Sie die Kontaktadressen der Ansprechpersonen, die für den ganzen Pastoralraum zuständig sind. Weitere Ansprechpersonen und Kontaktadressen finden Sie unter den einzelnen Pfarreien.
Notfall
Bei Todesfällen und seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns jederzeit über 056 491 00 82. Rückruf erfolgt so schnell wie möglich.
Das Sekretariat des Pastoralraums
Adresse und Öffnungszeiten des Pastoralraum-Sekretariats
Kath. Pfarramt
Vogelsangstrasse 2
5512 Wohlenschwil
056 491 00 82
E-Mail
Dienstag | 08.00 – 11.30 Uhr |
Donnerstag | 08.00 – 11.30 Uhr |
Das Seelsorgeteam des Pastoralraums
Das Katecheseteam des Pastoralraums
Der Vorstand des Pastoralraums
Der Vorstand setzt sich zusammen aus je zwei Vertreterinnen oder Vertretern der vier Kirchgemeinden. Er regelt die «weltlichen» Geschäfte des Pastoralraum wie Finanzen und Personalfragen.

Silvère Dagelet
Co-Präsident Vorstand Pastoralraum
Delegierter Kirchenpflege Fislisbach
Katholische Kirchgemeinde Dorfstrasse 11
5442 Fislisbach
079 691 75 69
E-Mail

Valerio Colacino
Co-Präsident Vorstand Pastoralraum
Delegierter Kirchenpflege Fislisbach
Katholische Kirchgemeinde Dorfstrasse 11
5442 Fislisbach
079 457 56 97
E-Mail

Stephanie Gloor
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierte Kirchenpflege Tägerig
Katholische Kirchgemeinde
Alte Poststrasse 6
5522 Tägerig
079 725 13 67
E-Mail

Peter Rothmaier
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierter Kirchenpflege Wohlenschwil-Mägenwil
Katholische Kirchgemeinde
Vogelsangstrasse 2
5512 Wohlenschwil
062 896 06 56
E-Mail

Bernd Göhl
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierter Kirchenpflege Mellingen
Katholische Kirchgemeinde
Kleine Kirchgasse 28
5507 Mellingen
079 201 50 48
E-Mail

Erna Oldani
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierte Kirchenpflege Tägerig
Katholische Kirchgemeinde
Alte Poststrasse 6
5522 Tägerig
079 307 55 46
E-Mail

Rosanna Sarina Costa
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierte Kirchenpflege Mellingen
Katholische Kirchgemeinde
Kleine Kirchgasse 28
5507 Mellingen
079 397 21 33
E-Mail

Esther Dreier-Wicht
Mitglied Vorstand Pastoralraum
Delegierte Kirchenpflege Wohlenschwil-Mägenwil
Katholische Kirchgemeinde
Vogelsangstrasse 2
5512 Wohlenschwil
078 724 26 63
E-Mail
Was ist zu tun bei …?
Was Sie unternehmen müssen bei einem Todesfall oder wenn Sie Ihr Kind taufen oder heiraten wollen usw.
Was ist zu tun bei einem Todesfall?
Sie haben einen Menschen verloren, der Ihnen nahe stand. Herzliches Beileid! Gerne gestaltet wir eine würdige Abschiedsfeier. Die Vorbereitung erfolgt bei einem Gespräch bei Ihnen zu Hause oder im Pfarrhaus. Den Bestattungstermin legen Sie in Absprache mit den Bestattungsämtern von Mellingen, Tägerig, Mägenwil oder Wohlenschwil und mit einer Seelsorgeperson fest. Sie erklären Ihnen gern die weiteren Schritte.
Kontakt
Sekretariat Pastoralraum
056 491 00 82
Was ist zu tun bei einer Taufe?
In der Taufe wird ein Kind in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Das geschieht in der Regel in einer kleinen, persönlichen Feier in der Kirche oder Kapelle des Wohnortes. Nehmen Sie über das Sekretariat mit dem Seelsorgeteam Kontakt auf. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger erklären Ihnen gern die weiteren Schritte.
Kontakt
Sekretariat Pastoralraum
056 491 00 82
Was ist zu tun bei einer Hochzeit?
Sie wollen in einer unserer Pfarreien heiraten? Das freut uns! Nehmen Sie spätestens sechs Monate vor dem gewünschten Hochzeitstermin über das Sekretariat Kontakt auf mit dem Seelsorgeteam. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger erklären Ihnen gern die weiteren Schritte.
Kontakt
Sekretariat Pastoralraum
056 491 00 82
Was ist zu tun bei Versöhnung und Beichte?
Im Sakrament der Busse und Versöhnung bekennt der Mensch seine Fehler und erfährt Vergebung. In unserem Pastoralraum geschieht das jeweils in Versöhnungsfeiern. Die Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung erfolgt im Religionsunterricht in der 4. Klasse und wird mit dem Versöhnungsweg abgeschlossen. Detaillierte Informationen dazu sind unter Religionsunterricht zu finden.
Kontakt
Sekretariat Pastoralraum
056 491 00 82
Was ist zu tun bei einer Krankensalbung?
Das Sakrament der Krankensalbung stützt kranke Menschen in ihrem Vertrauen auf Gott und stärkt ihre Hoffnung auf Gottes Beistand. Das Sakrament wird jedes Jahr in einem besonderen Gottesdienst gespendet. Gerne kommen wir auch auf Krankenbesuch und spenden den Krankensegen oder die Krankensalbung. Nehmen Sie über das Sekretariat Kontakt mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern auf.
Kontakt
Sekretariat Pastoralraum
056 491 00 82
Religionsunterricht und Jugendseelsorge
Ein engagiertes Katecheseteam sorgt in unserem Pastoralraum für die stufengerechte Hinführung von Kindern und Jugendlichen zum Glauben. Das geschieht im Religionsunterricht, bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion, die Firmung und das Versöhnungssakrament und bei ausserschulischen Veranstaltungen.
Religionsunterricht Primarschule 2025/2026
Der Religionsunterricht wird im aktuellen Schuljahr wie folgt erteilt:
Religionsunterricht 1. Oberstufe
Der Religionsunterricht findet im neuen Schuljahr ausserhalb der Schule im Blockunterricht statt. Du hast die Möglichkeit, den Unterricht entweder am Mittwoch, von 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr in Mellingen (Katholisches Vereinshaus) oder am Donnerstag, von 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr in Wohlenschwil (Pfarreiheim oberhalb der Kirche) zu besuchen. Hier die Termine:
Katholisches Vereinshaus Mellingen Mittwoch, 16.15 bis 17.45 Uhr | Pfarreiheim Wohlenschwil Donnerstag, 17.15 bis 18.45 Uhr |
|---|---|
17. September 2025 | 18. September 2025 |
22. Oktober 2025 | 23. Oktober 2025 |
19. November 2025 | 20. November 2025 |
06. Dezember 2025, Samstag gemeinsamer Ausflug | 06. Dezember 2025, Samstag gemeinsamer Ausflug |
21. Januar 2026 | 22. Januar 2026 |
18. März 2026 | 19. März 2026 |
29. April 2026 | 30. April 2026 |
13. Mai 2026, Mittwoch gemeinsames Grillieren | 13. Mai 2026, Mittwoch gemeinsames Grillieren |
Wichtig: Es wird erwartet, dass du jeweils eine Lektion pro Monat besuchst, entweder in Wohlenschwil oder in Mellingen. Kannst du nicht kommen, melde dich bitte rechtzeitig per Mail an alexandra.atapattu@pastoralraum-mellingen.ch ab. Vielen Dank!
Religionsunterricht 2. Oberstufe
Nach dem Unterrichtskonzept des Pastoralraums Region Mellingen finden in diesem Schuljahr folgende Projekte und Events statt:
Donnerstag, 25. September 2025, 18.00 Uhr Kath. Vereinshaus Mellingen
Ersatztermin vom letzten Jahr (Bräteln)
Zusammen verbringen wir einem gemütlichen Abend, um gemeinsam ins neue Schuljahr zu starten. Je nach Wetter bräteln wir oder backen gemeinsam Pizza. Für Essen und Getränke ist gesorgt.
Bitte unbedingt bis 20. 9. 2025 anmelden.
Mittwoch, 15. Oktober 2025, 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Spielenachmittag im Seniorenzentrum Tägerig
Treffpunkt: Seniorenzentrum Tägerig
Wir machen einen Freiwilligeneinsatz im Seniorenzentrum Tägerig.
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 13.30 bis ca. 16.00 Uhr
Brätzeli backen im Alterszentrum Grüt in Mellingen
Treffpunkt: Alterszentrum Grüt Mellingen
Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohner backen wir Brätzeli.
Mittwoch, 26. November 2025, 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Weihnachtsguetzli backen im Seniorenzentrum Tägerig
Treffpunkt: Seniorenzentrum Tägerig
Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern backen wir Guetzli.
Mittwoch, 21. Januar 2026, 13.30 bis ca. 16.30 Uhr
Brätzeli backen im Alterszentrum Grüt in Mellingen
Treffpunkt: Alterszentrum Grüt Mellingen
Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern backen wir Brätzeli
Mittwoch, 4. März 2025, 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Spielenachmittag
Treffpunkt: Seniorenzentrum Tägerig
Wir machen einen Freiwilligeneinsatz im Seniorenzentrum Tägerig.
Sonntag, 8. März 2026
Tägerig, Suppentag
Treffpunkt und Zeit: Nach Absprache
Für die Durchführung des Suppentags brauchen wir helfende Hände für die Vorbereitung am Samstag und den Service am Sonntag. Bitte angeben an welchem Tag du mithelfen möchtest.
Samstag, 14. März 2026, 8.30 bis 11.00 Uhr
Rosenverkauf
Treffpunkt: Vereinshaus Mellingen
Vor dem Coop in Mellingen verkaufen wir Fairtrade-Rosen für die Fastenaktion.
Sonntag, 15. März 2026
Wohlenschwil und Mellingen, Suppentag
Treffpunkt und Zeit: Nach Absprache
Für die Durchführung des Suppentags brauen wir helfende Hände für die Vorbe-reitung am Samstag und den Service am Sonntag. Bitte angeben, in welcher Pfarrei und an welchem Tag du mithelfen möchtest.
Donnerstag, 23. April 2026, 18.00 bis ca. 20.00 Uhr
Abendwanderung
Treffpunkt: Vor dem Vereinshaus Mellingen
Wir machen einen Besinnungsweg zur Lourdeskapelle Tägerig mit vier Stationen. Bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen! Findet bei jeder Witterung statt.
Mittwoch, 29. April 2026, 13.30 bis ca. 16.00 Uhr
Brätzeli backen im Alterszentrum Grüt in Mellingen
Treffpunkt: Alterszentrum Grüt Mellingen
Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern backen wir Brätzeli.
Samstag, 30. Mai 2026
Kirche Mellingen, Mithilfe Firmung
Treffpunkt und Zeit: 16.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
Mithilfe beim Apéro an der Firmung in Mellingen
Es wird erwartet, dass du in diesem Schuljahr mindestes vier Projekte oder Events besuchst. Suche dir vier Projekte oder Events aus und melde dich gleich an bei:
alexandra.atapattu@pastoralraum-mellingen.ch
WhatsApp: 079 578 83 82
oder via Klapp
Vorbereitung auf die Erstkommunion
In der dritten Klasse werden die Kinder von der Religionslehrerin sorgfältig auf die Erste Kommunion vorbereitet. Auch Mütter und Väter werden bei der Vorbereitung mit einbezogen.
Vorbereitung Erstkommunion
Leben ist Bewegung, Entwicklung und Veränderung. Gerade die Vorbereitung und Feier der Erstkommunion soll auch jungen Menschen einen Zugang zum Geheimnis Gottes eröffnen.
Eine Einführung in die Feier der Erstkommunion geschieht im Religionsunterricht der 3. Klassen und parallel dazu in der katechetischen Vorbereitung in den Pfarreien. Dabei ist es uns wichtig, auch die Bezugspersonen der Kinder aktiv miteinzubeziehen.
Versöhnungsweg
Im Sakrament der Busse und Versöhnung bekennt der Mensch seine Fehler und erfährt Vergebung. In unserem Pastoralraum geschieht das jeweils in Versöhnungsfeiern. Die Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung erfolgt im Religionsunterricht in der 4. Klasse und wird mit dem Versöhnungsweg abgeschlossen.
Das Wort «versöhnen» kommt von «Sühne» und bedeutet: «gutmachen» oder «beschwichtige». Unser Leben wird durch positive und negative Erfahrungen geprägt. Das Gewissen hilft uns zu unterscheiden, was gut und was schlecht oder böse ist, wo wir dem Menschen, der Schöpfung oder Gott gegenüber etwas schuldig bleiben. Die Versöhnung stiftet Frieden und stellt die Gemeinschaft wieder her. Der Begriff «Versöhnung» bezieht sich auch auf die Beziehung zu Gott. Durch die Schuld (schuldig bleiben) entfernt sich der Mensch von Gott. Die Versöhnung, das Wiedergutmachen, ist ein Angebot vom Menschen an Gott. Gottes Barmherzigkeit ist so gross, er nimmt uns an, so wie wir sind.
Roter Faden mit Perlen
Während des Schuljahres werden die Kinder der 4. Klasse lebensnah mit der Botschaft von Gottes- und Nächstenliebe vertraut gemacht. Über die Lebenskreise von Familie, Schule, Freizeit, Schöpfung und Beziehung zu Gott versuchen sie ihre Stärken und Schwächen herauszufinden. Zu den einzelnen Unterrichtseinheiten dürfen die Kinder jeweils eine „Perle“ auf einen roten Faden auffädeln, denn wie ein roter Faden geht Gott mit uns durch unser Leben.
Postenlauf mit Begleitperson
Im Juni machen sich die Kinder dann mit einer Person, die ihnen sehr vertraut ist, auf den Versöhnungsweg. Ein Postenlauf durch die Kirche lädt die Kinder mit ihrer Begleitperson ein, auf vielfältige, anschauliche Art und Weise über das Leben zu philosophieren. Sie überlegen, wo sie sich selber, den Mitmenschen, der Schöpfung und Gott gegenüber etwas schuldig geblieben sind und wie das wieder gut gemacht werden kann. In der Sakristei findet ein Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger statt. Alles, was die Kinder als Ballast empfinden, dürfen sie nun abladen.
Mit der letzten «Perle» vollenden die Kinder ihre Versöhnungskette und nehmen sie zur Erinnerung und als Andenken mit nach Hause. Mit dem Gottesdienst am folgenden Sonntag findet der Versöhnungsweg einen würdigen Abschluss.
Firmvorbereitung und Firmung
Firmung 2026 – «Baustelle Leben»
Samstag, 30. Mai 2026, 16.00 Uhr, Kirche Mellingen
Firmspender: Domherr Stefan Essig
Leitbild und Ziele
Die vielfältigen Lebensweisen der Menschen verlangen ein weites und differenziertes katechetisches Arbeitsfeld. Das Leitbild Katechese im Kulturwandel beschreibt Leitgedanken einer zeitgemässen Katechese. Daraus ergeben sich vielfältige Handlungsräume für die Katechese vor Ort.
Kirchlicher Religionsunterricht
Der Kirchliche Religionsunterricht vermittelt Wissen über das Christentum, die biblischen Grundlagen und die zentralen Traditionen und Werte. Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt aus Interesse am Christentum und der Katholischen Kirche. Gemäss Lehrplan werden im Religionsunterricht die Kompetenzbereiche Identität, Ausdrucksfähigkeit und Werte gefördert.
In den Primarklassen findet dieser Unterricht in der Regel an den verschiedenen Schulstandorten nach Klassen getrennt statt. In den oberen Klassen erfolgt der Unterricht mehrheitlich in Blöcken ausserhalb der Schule in den Räumlichkeiten der Pfarreien.
Katechese
Die Katechese führt in die eigene Glaubensgemeinschaft ein und dient der Einübung der religiösen Praxis. Auch die Vorbereitung auf den Sakramentenempfang (Taufe, Kommunion, Versöhnung) und die Entwicklung der eigenen Glaubensidentität sind zentrale Aspekte. Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt aus dem Wunsch nach Teilhabe am katholischen Glaubensleben. Gemäss Lehrplan werden in der Katechese die Kompetenzbereiche Gemeinschaft, Liturgie und Spiritualität gefördert.
Zur Beheimatung (Katechese) gehören verschiedenste gemeinsame oder pfarreispezifische Anlässe, wie Kinder- und Jugendgottesdienste, gemeinsame Mittagessen, Events, Ausflüge, …
Ökumenische Zusammenarbeit
Wir stehen in regelmässigem Austausch mit der Reformierten Kirche und arbeiten in zahlreichen Projekten eng zusammen.
Ökumenische Feier zum Weltgebetstag
Der Weltgebetstag ist eine weltumspannende Bewegung von Frauen aus vielen christlichen Traditionen. Jedes Jahr am ersten Freitag im März sind alle zum Feiern eines gemeinsamen Gebetstages eingeladen. Durch die Gemeinschaft im Beten und Handeln sind die Menschen aus vielen Ländern auf der ganzen Welt miteinander verbunden.
Die nächste Feier findet am Freitag, 6. März 2026, 19.30 Uhr im Kath. Vereinshaus in Mellingen statt und wird von Frauen aus Nigeria vorbereitet. Das Thema lautet: Ich will euch stärken, kommt!
Ökumenischer Suppentag
Jährlich finden in unseren Pfarreien ökumenische Suppentage statt.
Suppentage 2026
Sonntag, 1. März, 10.30 Uhr in der Kath. Kirche Fislisbach
Anschliessend wird im Kirchgemeindehaus eine Suppe serviert.
Der ökumenische Suppentag findet jedes Jahr alternierend in den Räumlichkeiten der Katholischen oder Reformierten Kirchgemeinde statt.
Sonntag, 8. März, 10.30 Uhr in der Kath. Kirche Tägerig
Anschliessend wird in der Mehrzweckhalle eine Suppe serviert.
Sonntag, 15. März, 10.30 Uhr in der Kath. Kirche Mellingen
Anschliessend wird im Kath. Vereinshaus eine Suppe serviert.
Sonntag, 15. März, 10.30 Uhr in der Kath. Kirche Wohlenschwil
Anschliessend wird in der Halle Blau eine Suppe serviert.
Ökumenische Feier zum Eidg. Bettag
Der nächste Gottesdienst findet am Sonntag, 20. September 2026, 10.30 Uhr in der Reformierten Kirche Mellingen statt.
Ökumenische Totengedenken
Totenfeiern 2026
Samstag, 31. November 2026, 16.00 Uhr auf dem Friedhof Mägenwil mit Musikverein Mägenwil-Wohlenschwil
Sonntag, 1. November 2026, 11.30 Uhr auf dem Friedhof Fislisbach mit Männerchor und der Musikgesellschaft Fislisbach
Sonntag, 1. November 2026, 10.30 Uhr in der Kirche Mellingen mit Johanneschor. Anschliessend gemeinsamer Gräberbesuch auf dem Friedhof unter musikalische Begleitung durch Bläsergruppe der Stadtmusik Mellingen
Sonntag, 1. November 2026, 14.00 Uhr in der Kath. Kirche Tägerig mit Mitwirkung Musikverein Tägerig
Sonntag, 1. November 2026, 14.00 Uhr in der Kath. Kirche Wohlenschwil mit Kirchenchor Wohlenschwil-Mägenwil
Ökumenischer Empfang des Friedenslicht
Sonntag, 14. Dezember 2025, 18 Uhr in der Kath. Kirche Fislisbach
Im Anschluss brennt in all unseren Kirchen das Friedenslicht.
Ökumenische Kindergottesdienste «Fiire mit Chline»
Ökumenische Kinderwoche
Ökumenische Kids-Tage in Fislisbach
Montag, 6. Juli – Freitag, 10. Juli 2026 in der Reformierten Kirche Fislisbach
Für alle Kinder, welche zum jetzigen Zeitpunkt den Kindergarten oder die erste bis fünfte Klasse der Primarschule besuchen! Von Montag bis Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr hören wir jeden Tag eine Geschichte und entdecken Neues in der Bibel. Wir basteln und spielen, bewegen uns drinnen und draussen, haben Spass und erleben viele Überraschungen. Jeden Nachmittag gibt es ein Zvieri und am Donnerstag einen spannenden Parcours. Am Freitag, 17.30 Uhr feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst zum Abschluss der Kidstage.
Kontakt: Sekretariat Reformierter Gemeindeteil Fislisbach, Feldstrasse 6, 5442 Fislisbach, sekretariat.fislisbach@ref-mellingen.ch
Kinderwoche in Mellingen
Vom Dienstag, 7. Juli bis Freitag, 10. Juli 2026 auf dem Areal der Reformierten Kirchgemeinde in Mellingen erleben wir gemeinsam vier abwechslungsreiche Nachmittage voller Spiel, Spass und spannender Geschichten. Wir treffen uns jeweils um 13.45 Uhr vor dem reformierten Kirchgemeindehaus Mellingen (am ersten Tag bereits um 13.30 Uhr). Das Programm dauert bis 17.30 Uhr.
Kontakt
Seniorenweihnachtsfeiern
Adventsfeier in Wohlenschwil
Alle reformierten und katholischen Seniorinnen und Senioren aus Mägenwil und Wohlenschwil ab 75 Jahren sind mit ihrer Lebenspartnerin bzw. ihrem Lebenspartner am Freitag, 5. Dezember 2025 von 14.30 Uhr bis 17 Uhr zu einer gemütlichen und besinnlichen Adventsfeier ins Pfarreiheim in Wohlenschwil eingeladen. Neben einem adventlichen Zvieri verzaubern Kinder der Musikschule die Feier mit einem Flötenkonzert. Zusätzlich wird eine weihnächtliche Geschichte erzählt und wir singen gemeinsam festliche Adventslieder.
Ökumenische Senioren-Weihnacht in Mellingen
Die Feier findet am Mittwoch, 10. Dezember 2025, 14.00 Uhr im Reformierten Kirchgemeindehaus Mellingen statt. Eingeladen sind die reformierten und katholischen Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren aus Mellingen und Tägerig. Die Gäste erwartet ein weihnächtliches Beisammensein mit Schulklassen der Primarschule Mellingen und ein feines Essen.
Die persönlichen Einladungen werden Mitte November in die Haushalte verschickt.
Aktion Weihnachtspäckli
Setzen auch Sie ein Zeichen und bringen Sie ein Weihnachtspäckli an eine unserer Sammelstellen. Ihr Päckli schenkt einem bedürftigen Menschen in Osteuropa Freude und Hoffnung.
Herzlichen Dank für alle Spenden und Weihnachtspäckli.
Ökumenische Sammelstelle
Ref. Kirchgemeindehaus
Feldstrasse 6, Fislisbach
Der Pastoralraum Region Mellingen
Bischof Felix eröffnet den Pastoralraum
Am Sonntag, 29. September 2019 hat der Basler Bischof Felix Gmür den Pastoralraum Region Mellingen eröffnet.
Kurz und schnörkellos war die Formel, mit der Bischof Felix Gmür nach seiner Predigt im Festgottesdienst am Sonntag, 29. September 2019, den Pastoralraum Region Mellingen formell errichtete. «Kraft meines Amtes als Bischof von Basel errichte ich den Pastoralraum …» Damit war die Umwandlung des 25-jährigen erfolgreichen Seelsorgeverbands Mellingen im Kanton Aargau mit den Pfarrgemeinden Mellingen, Tägerig und Wohlenschwil-Mägenwil in die neue Einheit vollzogen.
Bischof Felix hat in seiner Predigt zum Evangelium des armen Lazarus und einer Stelle aus dem Timotheusbrief den christlichen Kernauftrag erläutert. Wie in einem Feldlazarett sollen Christen offen sein für alle Menschen, auch für verletzte und geschwächte, und in Gerechtigkeit, Sanftmut und Liebe standhaft bleiben. Denn: «Christen sind keine Weicheier.»
Bei strahlendem Wetter waren Bischof Felix mit Bischofsvikar Christoph Sterkmann, Pfarrer Walter Schärli, Diakon Hans Zürcher und der kirchlichen Jugendarbeiterin Alexandra Atapattu und allen fünf Katechetinnen um 10 Uhr in die volle Stadtpfarrkirche von Mellingen eingezogen.
In seinem Grusswort blickte Walter Schärli, Pfarrer von Mellingen und Leiter des neuen Pastoralraums auch auf die «Countdown-Woche» zurück mit ihrem bunten Strauss von Anlässen zur Vorbereitung auf die Errichtung des Pastoralraums.
Bevor Gläubige und Bischof nach dem heiteren Gottesdienst mit stimmungsvollem Gesang zum Apéro-Buffett ins Katholische Vereinshaus schritten, überbrachte die Landeskirche Aargau ein Grusswort, und der ehemalige Kirchenpflegepräsident Heinz Haudenschild durfte von der aktuellen Kirchenpflegepräsidentin Sonja Nauer ein kleines Geschenk entgegennehmen für die Unterstützung, die er bei der Errichtung des neuen Pastoralraums zusammen mit Projektleiter Thomas Feierabend geleistet hatte.
Der Pastoralraum – ein Zweckverband
Der «Pastoralraum Region Mellingen» im Kanton Aargau ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Seelsorgeverbandes Mellingen. Die Kirchgemeinden Mellingen, Tägerig und Wohlenschwil-Mägenwil mit rund 4500 katholischen Gläubigen hatten sich bereits 1993 zu einem Seelsorgeverband zusammengeschlossen, um dem Priester- und Seelsorgermangel zu begegnen. Die Zusammenarbeit bewährte sich über Jahrzehnte sehr gut. Mit einem grossen Fest feierte der Seelsorgeverband 2013 sein 20-Jahr-Jubiläum.
Mit der Überführung des Seelsorgeverbandes in einen Pastoralraum rücken die Pfarreien Mellingen, Tägerig, Wohlenschwil-Mägenwil und seit 2023 auch Fislisbach auf pastoraler Ebene noch enger zusammen. Die Leitung der einzelnen Pfarreien liegt nun nicht mehr wie bisher bei einem pfarreieigenen Pfarrer oder Gemeindeleiter, sondern beim Leiter des gesamten Pastoralraums. Dieser – momentan vakant – nimmt mit seinem Team die seelsorgerlichen Dienste für sämtliche Pfarreien gemeinsam wahr.
Den Glauben ins Spiel bringen
Die Errichtung von Pastoralräumen wurde vom Bistum Basel angeordnet. Ausgangspunkt waren dabei die Erkenntnisse des «Pastoralen Entwicklungsplanes Bistum Basel (PEP)». Der Plan geht davon aus, dass die gesellschaftliche Entwicklung heute neuartige Anforderungen an die Seelsorge und das Seelsorgepersonal stellen. Die Gesellschaft ist komplexer und vielfältiger geworden.
Eine Pastoral, die nötig ist, um den Glauben in dieser vielfältigen Gesellschaft ins Spiel zu bringen, übersteigt aber oft die Möglichkeit einer einzelnen Pfarrei. Es braucht grössere Organisationsräume, Schwerpunktbildung, Arbeitsteilung, um auf vielfältigere Weise den Menschen nahe sein zu können. In grösseren Räumen können die seelsorgerlichen Aufgaben auch besser auf das verfügbare Personal und seine Fähigkeiten aufgeteilt werden, so die Idee des Bistums.
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Auf staatskirchenrechtlicher Seite ändert sich beim Pastoralraum Region Mellingen gegenüber der Praxis des früheren Seelsorgeverbands Mellingen nicht viel.
Die vier Kirchgemeinden Mellingen, Tägerig, Wohlenschwil-Mägenwil und Fislisbach bilden nun den «Zweckverband der Kirchgemeinden innerhalb des Pastoralraumes Region Mellingen» und bestehen juristisch als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. In den Zweckverband können auch weitere Kirchgemeinden aufgenommen werden, wenn deren Anschluss zweckmässig ist.
Oberstes Organ des Verbandes ist die Kirchenpflegeversammlung, die sich aus allen Mitgliedern der Kirchenpflegen in den Verbandsgemeinden zusammensetzt. Ausführendes Organ des Verbandes ist der Vorstand, der aus je zwei Mitgliedern der Verbandsgemeinden besteht.
Der Verband bezweckt, die Pastoral im Pastoralraum «Region Mellingen» durch die Anstellung des kirchlichen Personals, durch die Finanzierung der Sachmittel und durch die Bereitstellung der Infrastruktur mitzutragen.
Das Logo des Pastoralraums

Abgegrenzt und doch nach aussen hin offen. Ein schützender Raum und doch in die Höhe weisend, zur Tiefe führend und in die Weite verbindend, das ist die Bewegung, welche die drei farbigen Schweife auslösen. Das Zentrum markiert im gelben Kreis das Suchen nach der eigentlichen Mitte, nach Gott. Und flankiert wird es an den Rändern vom Rot der Liebe, vom Grün der Hoffnung und vom Blau der Treue und des Glaubens. Die Liebe drängt nach oben, zum Himmel hin, als ob in der Liebe die Krönung all dessen liegt, was der Mensch auf Erden sucht. Die Hoffnung lässt sich erden, als ob jede Vision und jeder Traum auf festem Boden abgestützt sein muss. Die Treue und der Glaube lenken in die Weite und Unendlichkeit, als ob Engstirnigkeit niemals das Merkmal von Christen sein kann. Und alle drei Schweife öffnen sich nach aussen und nicht nach innen. Selbstbespiegelung steht der Kirche schlecht an. Der Dienst an den Menschen ist gefragt und nicht die Stärkung der Machtstrukturen.
Und wer den Blick auf das ganze Logo richtet, dem widerfährt Dynamik und nicht Statik. Wie ein Windrad wollen sich die drei Schweife drehen. Der Pastoralraum wird gleichsam von einer Bewegung ergriffen, mag nicht zur Ruhe kommen, obwohl in der Mitte ein ruhender Pol liegt, der allem Tun einen sicheren Halt gibt, gleich einem Felsen in der Brandung.
Wenn der Text rechts angegliedert ist, verweist das auf die rechte Hand, die bekanntlich die gebende ist. Der Pastoralraum ist also nichts anderes als die entgegengestreckte Hand, die einladend zur Liebe, zum Glauben und zur Hoffnung hinführen will.
Johannes Zürcher, ehemaliger Diakon im Pastoralraum und Schöpfer des Logos